Angst: Warum sie so wichtig für uns sein kann
Angst ist eine unserer sieben Grundemotionen und betrifft uns alle – ein Glück, denn ohne sie könnten wir nicht überleben. Psychiaterin Katharina Domschke weiß, wie Angst uns schützt, was dabei im Körper passiert und wann sie nicht mehr gesund ist.

Foto: mauritius images / Maskot
carpe diem: Wie wichtig ist Angst für uns?
Prof. Dr. Dr. Katharina Domschke: Enorm wichtig. Sie ist wahrscheinlich unsere wichtigste Emotion überhaupt, weil wir ohne sie nicht überleben könnten. Die Angst ist unser eingebautes Alarmsystem, sie warnt uns vor Gefahren. Dank ihr können wir Bedrohungen etwas entgegensetzen – also entweder fliehen, uns wehren oder totstellen. Wir kennen das als Fight-, Flight- oder Freeze-Reaktion.
Okay, kämpfen oder wegrennen, das klingt logisch. Aber ich hatte noch nie den Impuls, mich totzustellen …
Ja, die Freeze-Reaktion ist im Tierreich gängig, beim Menschen heute aber nur selten sinnvoll. Eigentlich nur dann, wenn man einem Bären begegnet. Sie ist auch nicht zu empfehlen, da sie schnell zur Lähmung und zur depressiven Reaktion führen kann.
Die Angst ist unser eingebautes Alarmsystem, sie warnt uns vor Gefahren. Dank ihr können wir Bedrohungen etwas entgegensetzen – also entweder fliehen, uns wehren oder totstellen.
Katharina Domschke
Wo entsteht Angst? Und was passiert dabei in meinem Körper?
Stellen Sie sich vor, sie sehen eine Schlange. Sie könnte giftig sein, deshalb muss jetzt alles ganz schnell gehen. Dieser eingebaute reflexhafte Mechanismus läuft wie folgt ab: Der visuelle Kortex sendet das Signal „Achtung Schlange!“ über den Thalamus direkt zur Amygdala, auch Mandelkern genannt. Sie ist unsere Gefühlszentrale und agiert wie ein Rauchdetektor, der sofort anspringt, wenn nur das leiseste Anzeichen von Bedrohung da ist. Die Amygdala schickt dann sofort ein Warnsignal an den Hirnstamm, wo sich der sogenannte Locus coeruleus befindet – das ist eine Struktur, die Adrenalin ausschüttet und den ganzen Körper damit flutet.
Und dann beginnt mein Herz wie wild zu rasen …
Ja, genau. Der Herzschlag geht nach oben, die Atmung beschleunigt sich, um möglichst viel Sauerstoff aufzunehmen. Das sind körperliche Voraussetzungen dafür, dass eine Fight- oder Flight-Reaktion besonders gut ablaufen kann.

Depression, Angst, Burnout? Reden wir darüber!
Mit ihrem neuen Podcast „Im Rausch des Lebens“ treten die Künstlerin Verena Titze und der Sucht-Experte Prof. Michael Musalek an, um Mental Health Themen zu enttabuisieren. Wir finden: Zeit wird's – und baten Verena, das Projekt vorzustellen. Weiterlesen...
Das ist super, wenn Gefahr droht. Aber was, wenn die Schlange gar nicht giftig ist? Wie fährt mein Alarmsystem dann wieder runter?
Der Weg, den ich beschrieben habe, ist die sogenannte Low Road. Sprich: der schnellste Weg zu einer überlebenswichtigen Schutzreaktion, bevor uns die Bedrohung überhaupt bewusst wird. Dabei wird der präfrontale Kortex, das Vernunftsgehirn und quasi der Reiter der Amygdala, der die Zügel über sie in der Hand hält, aber umgangen. Geht die Amygdala nun durch, kann der präfrontale Kortex die Zügel anziehen und sie zurückpfeifen. Das tut er, indem er abwägt, ob das wirklich eine giftige Schlange oder nur eine Blindschleiche ist, und dafür muss er abgleichen. Dafür hält er Rücksprache mit dem Hippocampus, unserem Gedächtnisareal. Dort wird im Brockhaus der Schlangen geblättert, welche Muster hat sie und so weiter. Dann kann der präfrontale Kortex im Fall des Falles Entwarnung geben. Das ist die High Road.
Geht die Amygdala nun durch, kann der präfrontale Kortex die Zügel anziehen und sie zurückpfeifen.
Katharina Domschke
Gibt es Körperregionen, in denen wir Angst besonders spüren?
Das Herz spielt eine große Rolle. Der Herzschlag wird schneller und spürbarer – es kommt also zu Herzrasen und Herzklopfen. Dann spüren wir es im Bauch, viele bekommen Durchfall. Man sagt deshalb auch „Ich habe Schiss“, weil all der Ballast im Darm, der einen an der Flucht oder am Kampf hindern könnte, dann schnellstmöglich abtransportiert werden muss. Wir atmen auch schneller, zittern, schwitzen oder spüren leichten Schwindel.
Bis zu welchem Grad ist Angst normal und ab wann hat sie eine Krankheitswert?
Alles Angstformen liegen auf einem Spektrum. Angst ist völlig normal und gehört zum Basisrepertoire unserer Gefühle. Das kann sich aber natürlich steigern bis zum anderen Ende des Spektrums, bis hin zur Angsterkrankung.

Werkzeugkasten für die Seele
Wie bleibt der Lebensmut erhalten? Womit holt man sich selbst wieder aus einem Tief heraus? Wissenschaftsjournalist Bas Kast hat einiges ausprobiert: von Apps bis Kälteschocks, von Meditation bis zu kratzendem Olivenöl. Weiterlesen...
Ist Angst angeboren?
Ja, auch, etwa gerade die Angst vor Schlangen oder Spinnen. Das sind uralte Schemata, für die es eine genetische Grundlage gibt. Das geht zurück auf unsere Urururahnen, die mit gefährlichen Tieren in der Wildnis gelebt haben. Deswegen hat sich das so tief in unser Genom eingeprägt. Damit wurde sichergestellt, dass jede Generation sofort vor diesen lebensbedrohlichen Wesen Angst hat. Und diese Gene haben sich fortgepflanzt. Nur: Jetzt haben wir leider auch vor den Abziehbildern dieser gefährlichen Tiere Angst, die an die Form dieser Tiere gemahnen. Das überträgt sich auch auf harmlose Hauskatzen und Co.

Arzt & Bestsellerautor Dietrich Grönemeyer: Ängste in den Griff bekommen – wie geht das in Zeiten wie diesen?
In dieser Folge plaudern wir mit dem renommierten Wissenschaftler über den richtigen Umgang mit Angst und wie man innere Unsicherheiten überwinden kann. Weiterlesen...
Gibt es auch noch andere Mechanismen, warum man Angst hat?
Das geschieht einerseits durch Imitation, das sogenannte Modelllernen: Beobachtet ein Kind etwa, dass die Mutter beim Überqueren von vielbefahrenen Straßen immer den Fußgängerübergang benützt, verspürt später auch der Nachwuchs ein hilfreiches Angstgefühl. Andererseits entstehen Ängste durch Konditionierung. Dabei lernen wir, dass unser Verhalten eine bestimmte Konsequenz hat, was aber auch unnötige Ängste hervorbringen kann. Wenn Sie etwa immer wieder den Fußgängerübergang benützen, Autofahrer aber trotzdem nicht anhalten, kann sich daraus eine konditionierte Angst entwickeln. Sie haben nun grundsätzlich Angst vor dem Überqueren von Straßen.
Neue Zeiten bringen auch neue Gefahren. Wie schützen wir uns vor diesen?
Angst besitzt eine hohe Plastizität, das heißt, sie kann auch auf neue Bedrohungen reagieren – Terror, Klimawandel, Ausgrenzungen von Fremden, wirtschaftliche Instabilität, Kriege sind hier ein paar Schlagworte. Hier ist Angst zum einen ein Warnsignal, das im Sinne einer gesellschaftlichen Fight-Reaktion sinnvolle Veränderungen anstoßen kann, zum anderen sollte sie uns nicht lähmen und vor lauter Zukunftsangst die notwendigen Schritte in der Gegenwart verhindern.

Therapeutin Larissa Kranisch: Klettern als Therapie gegen Depression und Angst
Bewegung als Therapie und die daraus resultierenden positiven Veränderungen – darum geht’s in der neuen Folge. Und ganz nebenbei bescheren uns Klettern und Bouldern einen Perspektivenwechsel. Weiterlesen...
Wie können wir Ängste überwinden? Und sollen wir das überhaupt, wenn sie doch so wichtig sind?
Wir wollen die Angst nicht überwinden, weil sie überlebensnotwendig ist. Angst muss nicht weggemacht werden, Angst muss zum Freund gemacht, als sinnvoller Ratgeber, als Impuls für den Mut und notwendige Maßnahmen gegen Bedrohungen betrachtet werden. Was wir überwinden sollten, ist die ängstliche Reaktion auf Situationen, in denen wir keine Angst zu haben brauchen. Dabei hilft, wenn die Angst bereits einen Krankheitswert hat – sie das soziale oder berufliche Leben also massiv beeinträchtigen – eine Psychotherapie oder auch eine medikamentöse Therapie mit gut verträglichen und nicht abhängig machenden Antidepressiva.
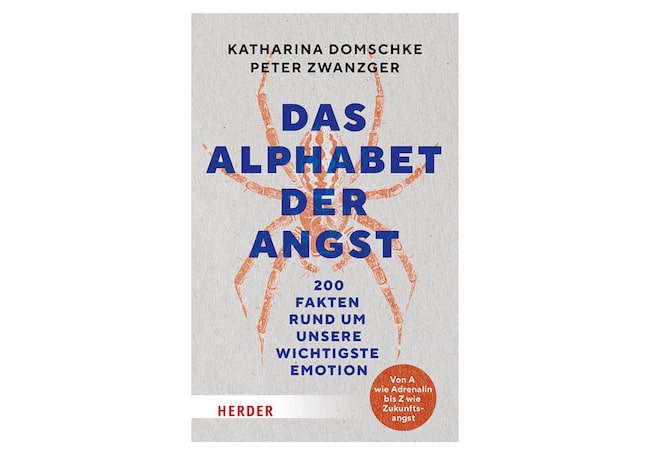
Buchtipp:
Faszinierend und Respekt einflößend zugleich – die Angst. Jeder kennt sie. Sie ist lebenswichtig, weil sie uns vor Gefahr schützt. Allerdings fühlt sie sich alles andere als gut an, weshalb sie meist verdrängt und selten angesprochen wird. Prof. Katharina Domschke und Prof. Peter Zwanzger, international anerkannte klinische wie wissenschaftliche Experten auf dem Gebiet der Angsterkrankungen, nehmen uns mit ihrem Buch „Das Alphabet der Angst. 200 Fakten rund um unsere wichtigste Emotion“ (Herder) die Angst vor der Angst.


