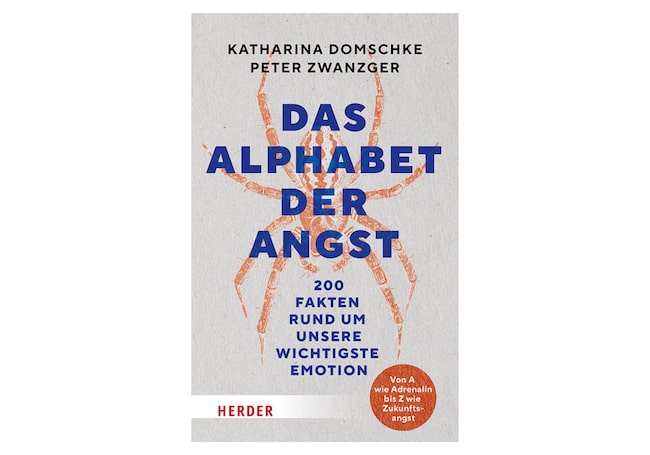Was ist Angst und welche Arten gibt es?
Angst ist ein komplexes Gefühl, das uns auf unterschiedlichste Weise begegnet. Aber wodurch unterscheidet sie sich eigentlich von Furcht oder Panik? Was sind Phobien und wie wird man diese Gefühle wieder los? Antworten liefert unser kleines ABC der Angst.

Foto: pexels.com/Nataliya Vaitkevich
Angst hat viele Gesichter. Psychologin und Psychiaterin Katharina Domschke erklärt die unterschiedlichen Facetten und Aspekte der (zunächst einmal völlig normalen) Grundemotion.
Das kleine ABC der Angst
Angst ist immer ungerichtet. Die Expertin spricht „von einem frei flottierenden, wabernden Gefühl“, das vielfach in die Zukunft gerichtet ist, auf etwas Unvorhersehbares und Unkontrollierbares.
Furcht hat hingegen immer ein konkretes Gegenüber. Sie ist auf ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Situation bezogen, die auch benannt werden kann, also etwa die Dunkelheit oder die Zahnärztin.
Panik ist ein Ausdruck von Angst oder Furcht und eine hauptsächlich körperliche Reaktion. Verfallen wir in Panik, beginnt etwa unser Herz zu rasen und zu klopfen, wir schwitzen, bekommen Schwindel oder Durchfall.
Furcht hat immer ein konkretes Gegenüber. Sie ist auf ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Sache bezogen.
Katharina Domschke
Schreck ist der Psychiaterin zufolge eine „unmittelbare, zeitlich begrenzte Reaktion auf etwas Unerwartetes, Unangenehmes oder Angsteinflößendes.“ Dieses körperliche Wachsamkeitsgefühl, in das wir augenblicklich versetzt werden (auch als Startle-Reflex bekannt), ist die schnellste unter den Angstreaktionen und kaum steuer- oder unterdrückbar. Wir kennen das u.a. aus Filmen, wenn plötzlich der Zombie um die Ecke biegt oder ein heftiges Geräusch die Stille durchbricht – der sogenannte „Jump-Scare“.
Schrecken ist hingegen ein länger anhaltender Zustand seelischer Not.
Sorgen sind kognitive Ängste. Da geht es um das Worrying, wir sorgen uns beispielsweise um die Gesundheit unserer Angehörigen, die Finanzen oder die soziale Situation. Sorgen finden vorwiegend auf gedanklicher Ebene statt, können sich aber auch auf den Körper niederschlagen. Wir sind dann u.a. reizbarer oder schlafen schlechter.
Angsterkrankung: Insgesamt gibt es fünf unterschiedliche Angsterkrankungen, die in zwei große Gruppen unterteilt werden:

Psychologin Stefanie Stahl: Wie du Bindungsängste heilen kannst
Wie wir als Menschen Dinge wahrnehmen und wie man mit Bindungsängsten auflösen kann – darauf gibt es spannende Antworten in dieser Podcastfolge. Weiterlesen...
1. Phobien: Was allen Phobien gemeinsam ist: Man vermeidet das, was man fürchtet. Und das ist dann eben das Krankheitskriterium. „Fürchtet man etwas und macht es trotzdem, ohne dabei massive Ängste auszustehen, ist es keine pathologische Phobie“, so Katharina Domschke. „Vermeidet man es aber und hat dadurch Beeinträchtigungen im alltäglichen, sozialen oder beruflichen Leben, dann wird es krankhaft.“
Phobien lassen sich wiederum in drei Kategorien unterteilen.
- Spezifische Phobien, davon gibt es eine Vielzahl an Subformen, etwa die Spinnenphobie, Akrophobie (Höhenangst) oder Klaustrophobie. Letztere ist die Platzangst, also die Angst vor kleinen Räumen, nicht zu verwechseln mit der Agoraphobie (siehe Punkt 1.2.).
- Die Agoraphobie beschreibt wörtlich die „Angst vor dem Marktplatz“ (aus den altgriechischem Begriffen Agora + Phobie). Mit dem Marktplatz hat sie aber nur insofern zu tun, als es dort meistens sehr voll ist – die Angst bezieht sich also auf Situationen, in denen man im Notfall keine Hilfe bekommen kann, weil der Krankenwagen nicht durchkommt. Man meidet etwa das Fußballstadion oder macht keine Fernreisen.
- Die soziale Phobie meint die Angst, sich in den Augen anderer zu blamieren. Das führt dazu, dass wir uns in der Schule nicht melden, vor anderen nicht essen oder sprechen wollen etc.
Was allen Phobien gemeinsam ist: Man vermeidet das, was man fürchtet
Katharina Domschke
2. Andere Angsterkrankungen:
Dazu zählen u.a.:
- Die Panikstörung: Ihr Kernmerkmal sind laut der Expertin wiederholt auftretende Panikattacken, die „out of the blue“, also völlig unvermittelt und nicht auf bestimmte Situationen und Auslöser bezogen auftauchen. Die Attacken dauern in der Regel zwischen fünf und 30 Minuten, dazwischen gibt es auch tagelange symptomfreie Intervalle. Körperliche Symptome sind u.a. Herzklopfen, ein Engegefühl in der Brust und Atemnot. Betroffene haben während einer Panikattacke große Angst, „verrückt“ zu werden oder gar zu sterben.
- Die generalisierte Angststörung: „Die Sorgen, die sich Betroffene machen, sind auch für gesunde Personen verständlich, das Krankhafte liegt im Umgang damit“, so Domschke: „Menschen mit generalisierter Angststörung sind nicht in der Lage, ihre Sorgen durch reflektierte Überlegungen selbst zu relativieren, sie in ein angemessenes Verhältnis zwischen tatsächlicher Gefahr und gegebener Sicherheit zu stellen.“ Patienten können also nicht loslassen, was dazu führt, dass sie sich den ganzen Tag (und große Teile der Nacht) mit unterschiedlichen und meist unbegründeten Sorgen beschäftigen.

Depression, Angst, Burnout? Reden wir darüber!
Mit ihrem neuen Podcast „Im Rausch des Lebens“ treten die Künstlerin Verena Titze und der Sucht-Experte Prof. Michael Musalek an, um Mental Health Themen zu enttabuisieren. Wir finden: Zeit wird's – und baten Verena, das Projekt vorzustellen. Weiterlesen...
Die gute Nachricht: Angsterkrankungen lassen sich vor allem in der frühen Phase mit einer Expositionstherapie überwinden (dabei setzt sich der Betroffene dem gefürchteten Objekt bzw. der gefürchteten Situation bewusst aus). Der Patient mit einer Spinnenphobie nähert sich einer haarigen Vogelspinne, die Patienten mit einer sozialen Phobie hält kleine Vorträge vor einem kritisch blickenden Publikum, der Patient mit einer generalisierten Angststörung setzt sich auf einen definierten „Sorgenstuhl“ und muss sich für 15 Minuten ununterbrochen Sorgen machen.