Was passiert, wenn man drei Tage lang schweigt
Nichts sagen, aber auch nicht ins Handy schauen, den Computer oder den Fernseher. Nur unsere Autorin – und hunderte Gedanken, die diese ganz schön ins Schleudern gebracht haben. Ein Selbsterfahrungs-Bericht.
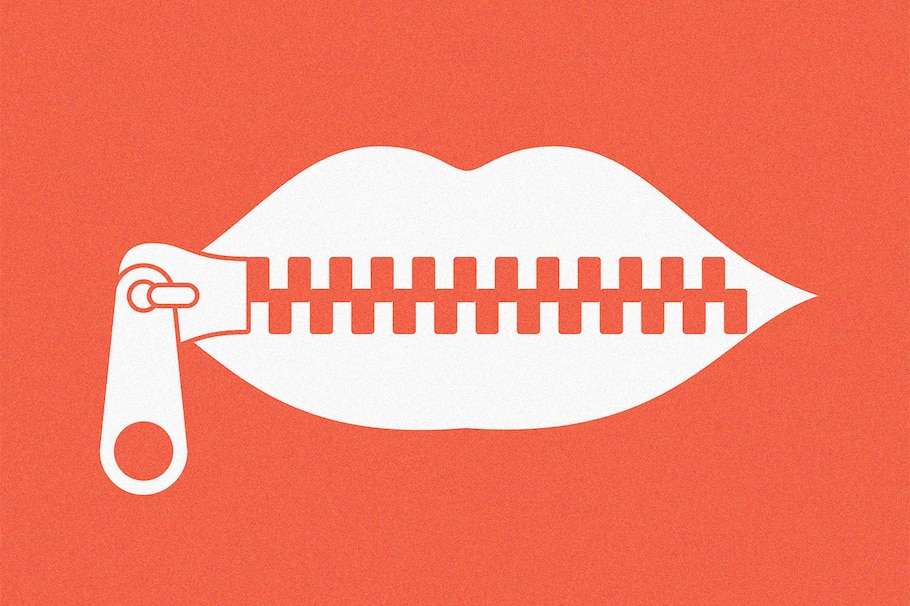
Bild: GettyImages
Wann schweigen wir? Selten. In der Kirche vielleicht. Oder wenn wir beleidigt sind, nach einem Streit. Aber sonst werden wir von Lärm diktiert – mitunter auch in „stiller“ Form, in den sozialen Medien als Dauer-Plapper-Gewitter. Ich habe mich gefragt, wovon uns das ablenkt, wovon mich das ablenkt. Das herauszufinden, lohnt sich, dachte ich mir. Und habe mich entschieden, irgendwann einmal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, eine Zeitlang nichts zu sagen.
Ich habe mich gefragt, wovon uns das Dauerplappern ablenkt, wovon mich das ablenkt. Das herauszufinden, lohnt sich, dachte ich mir.
Stille kannte ich schon. Im Rahmen meiner Ausbildung zur Shiatsu-Praktikerin habe ich erstmals in meinem Leben erfahren, wie es ist, ganz ruhig zu sein. Die Sitzung – so wird es genannt, wenn man einem anderen Menschen Shiatsu gibt – ist von Stille geprägt. Es wird nicht gesprochen.
Im besten Fall, denn es gibt schon auch Leute, die es nicht aushalten, sich wortlos zu entspannen und nicht aufhören können, zu erzählen. Sei es nur, wie der Gugelhupf bei der Jause mit der Schwiegermutter am Sonntag geschmeckt hat.
Drei Tage totales Schweigen
Doch sonst ist da nur dieser Rhythmus des Atems, des eigenen, des anderen, der Rhythmus von Berührung und Loslassen. Eine Stunde lang. Und die nächste. Und noch eine. So wunderbar das klingt – das Plauschen geht trotzdem weiter, in Form tausender Gedanken. Ein inneres Geplapper. Die Kunst ist nur, es kommen und ziehen zu lassen. Eine Frage der Übung. Gelungen ist es mir noch nicht oft.
Irgendwann ergab sich für mich dann tatsächlich die Gelegenheit des Schweige-Experiments. Drei Tage Stille – aber nicht irgendwo in einem geschützten Retreat oder Seminar, umgeben von Natur und würdigen Räumen, sondern daheim, im Alltag, in den eigenen vier Wänden. Die ganze Familie war ausgeflogen, drei Tage nur für mich. Ich hatte die Wahl: Gehe ich aus, treffe ich Leute, gehe ins Kino, Kabarett oder Theater?
Nur ich, meine Gedanken und das, was es zu tun gilt Warten, der Stille lauschen und dann aushalten, was kommt.
Ich entschied mich für das Abenteuer anderer Art: Handy abschalten, Computer und Fernseher ebenso. Mich mit Lebensmittel eindecken, die Türglocke und andere mögliche Einflüsse so gut es geht, überhören. Maximal wo bitte sagen und danke. Nichts also, das mich wegholt aus der Wortlosigkeit. Nur ich, meine Gedanken und das, was es zu tun gilt: Warten, der Stille lauschen und dann aushalten, was kommt.

Der Weg zur Stille
Der laute Alltagstrubel verstellt uns die Sicht. In der Stille bekommen wir einen klaren Blick. Astrid Wecht nimmt uns mit auf eine heilsame Reise zur inneren Stille. Weiterlesen...
Ich bekam Angst, Fragen tauchten auf: Werde ich mich allein fühlen? Werde ich die lange Weile aushalten, sie als Langeweile empfinden? Werde ich nervös, zornig, traurig, sehnsüchtig, womöglich depressiv? Was wird diese etwas andere „Fastenzeit“ für mich bedeuten? Was werde ich tun? Kommunikation ist mein Job. Was macht es mit mir, wenn ich verstumme?
Tag 1: Ist lautes Gähnen erlaubt?
Ich erwache, gähne laut – und erschrecke mich damit selbst. Ist lautes Gähnen erlaubt? Ich lache – ebenso laut – und fast kommt es mir vor als würde mein Körper justament irgendwas „sagen“ wollen: Ätsch, ich bin nun mal laut! Die erste Herausforderung - Frühstück. Normalerweise wird da geredet. Meist nix Großes, Bedeutendes (das heben wir uns für den Abend auf). Aber es ist laut. Jetzt sitze ich da, mit meinem Tee (Kaffee lass ich aus, weil ich finde, der passt nicht zur Stille) und höre dem Knuspern des Vollkorntoasts und meinem Mampfen zu. Ich sitze also und esse – sonst nichts. Furchtbar.

ild: Asique Alam/Unsplash
Innerlich sage ich mir meine Schweige-Gebote vor: Nein, kein Ipad. Nein, kein Magazin. Kostet Überwindung – der Effekt: Ich konzentriere mich tatsächlich aufs Essen und kaue langsamer als sonst. Notiz an mich: In Stille essen = intensiver schmecken und genießen. Mahlzeit.

Endlich richtig essen (lernen)
Der „Suppen-Kaspar“ sitzt noch immer bei Tisch und verweigert seine Mahlzeit – nur dass er heute „Picky Eater“ oder „Supertaster“ heißt. Für betroffene Kinder und ihre Eltern kann das zur großen Belastung werden. Die weltweit erste „Esslernschule“ in Graz hilft mit einer ungewöhnlichen Therapie. Weiterlesen...
Der Vormittag ist länger als sonst, die Zeit tropft dahin – ich mache ein paar Atem- und Yogaübungen und bemerke dabei den Schmutz auf dem Boden. „Du könntest jetzt putzen“, sagt was in mir. „Frau Ablenker“ nenne ich diese Stimme fortan, sie ist immer da, nicht wegzukriegen, hockt auf meinen Schultern und lässt mich nicht in Ruhe. Das Putzen würde mir sicher helfen, mich von mir selbst abzulenken. Ich lasse es trotzdem sein – und atme dagegen an.
Das Atmen hilft. Es führt mir den Rhythmus der Natur vor Augen Yin, Yang.
Das Atmen hilft. Es führt mir den Rhythmus der Natur vor Augen: Yin, Yang: Einatmen, ausatmen, aufnehmen, abgeben, aufgreifen, loslassen. Was ich gelernt habe: Wer nur „yangig“ unterwegs ist, brennt auf Dauer aus. Stille ist Yin, ist Rückzug, ist Winter, ist Einmummeln, ist Erholung. Auch Rhythmus ist Erholung. Und dann sitze ich tatsächlich nur da, atme ein und atme aus, um gleichzeitig ins „Narrenkastl“ zu starren. Willkommen im Rhythmus des Nichts.
Irgendwann spüre ich das Bedürfnis zu rennen – und, ja zu schreien. Ich tu’s nicht.
Und dann. Dann werde ich plötzlich sehr, sehr müde.
Spazierengehen habe ich mir für diese Zeit nicht nur erlaubt, sondern verordnet. Ich wohne Gott sei Dank draußen, in der Nähe eines Waldes. Dort hinzugehen, erscheint mir passend. Was mir auffällt: Mein Mund wird trocken. Ob das mit dem Schweigen zu tun hat? Notiz an mich: Abwarten. Tee trinken!

„Beim kohärenten Atmen gibt es keine Pausen“
Atem- und Bewegungsexpertin Griet Verstrate erklärt die Entspannungstechnik und wie sie auf den Körper wirkt. Weiterlesen...
Das Spazieren ist schön, wieder eine Chance, eigene Rhythmen zu finden: Diesmal geht es ums Tempo. Welcher Schritt passt zu meinem Atem? Wonach ist mir? Begegnet mir ein anderer Mensch, senke ich den Blick. Ich will schließlich bei mir bleiben und womöglich fragt mich einer nach dem Weg.
Das Spazieren ist schön, wieder eine Chance, eigene Rhythmen zu finden.
Irgendwann spüre ich das Bedürfnis zu rennen – und, ja: zu schreien. Ich tu’s nicht. Frau Ablenker mutiert zur inneren Kritikerin und Anklägerin: Bitte, wie deppert muss man eigentlich sein – wozu machst du den Blödsinn? Komische Erinnerungen tauchen in mir auf, im Bauch und rund ums Herz – Schmerz. Ich schaue in den Himmel und einer Wolke beim Ziehen zu. Der „Verlust“ meiner Worte macht mich traurig, erinnert mich an andere Verluste. Aber auch daran, wie oft ich geschwiegen habe, obwohl ich reden hätte müssen. Gedankenketten-Kaskaden. Der Redeschwall hat sich nach innen verlagert.
Der ‚Verlust' meiner Worte macht mich traurig, erinnert mich an andere Verluste.
Ich weine ein paar Tränen. Notiz an mich: Beim nächsten Spaziergang Taschentücher mitnehmen.

4 Wege, inneren Frieden zu finden
Meditations-Coach Astrid Wecht erklärt, wie es uns gelingen kann, konstruktiv mit belastenden Emotionen umzugehen und gelassen zu bleiben. Weiterlesen...
Jede Stunde dieses ersten Tages zu beschreiben, würde dieses Format sprengen. Am besten lässt es sich mit einem „Auf und Ab“ beschreiben, dessen Zwischenräume mit Zweifel und starken Gefühlen gefüllt sind. Da ist viel Fülle, aber auch viel Leere. Beides zugleich. Was ich mir allerdings schon erlaube, ist Lesen. Doch nur Dinge, die zum Thema dieser drei Tage passen, zum „Nicht-Reden“, zur Stille, zum „Nichts“.
Da ist viel Fülle, aber auch viel Leere. Beides zugleich.
Ich greife zu einem meiner Lieblingsbücher, „Innehalten“ von Flora Sekura Wöss. Auf Seite 169 lese ich unter dem Titel „Stille ist die Nahrung, die wir heute brauchen“ folgende Anekdote: "Ein Zen-Schüler kommt zu seinem Lehrer und fragt: Was ist der Weg? Der Lehrer antwortet: Hörst du das Rauschen des Regens? Das ist der Eingang."
Gegen Abend wünsche ich mir das Geräusch von Regen. Ich schlafe unruhige sieben Stunden, ich glaube sogar, ich habe geschnarcht.
Tag 2: ein Angstknödel im Magen
Als ich aufwache, fällt mir mein Handy ein. Normalerweise greife ich morgens rasch zum Smartphone, um zu schauen, was in der Welt passiert ist, wer mir welche Mails wann geschrieben hat – und welche Nachrichten. Es nicht zu verwenden, macht mich unruhig – ja, nervös.

Bild: Verne Ho/Unsplash
Frau Ablenker mahnt: Was ist, wenn etwas ist, du aber nicht erreichbar bist? Was ist, wenn etwas passiert ist? In meiner Magengegend grummelt sich ein Sorgenknödel zusammen. Angst, ein mir altbekanntes Gefühl. Das ich heute ausnahmsweise nur mit mir teilen kann, mit sonst niemandem. Normalerweise wird die Angst von meinen Worten über-redet und übermalt, da muss ich sie weniger fühlen. Jetzt hockt sie da, an und in meinem Bett und malt mir aus, was alles sein könnte.
Normalerweise wird die Angst von meinen Worten über-redet und übermalt, da muss ich sie weniger fühlen. Jetzt hockt sie da.
Die Angst wird so groß, dass ich tatsächlich das Telefon einschalte und schnell meine Mails und WhatsApp checke. NICHTS. Jetzt ärgere ich mich über mich selbst. So wenig Vertrauen in die Welt, in mich, ins Leben. Notiz an mich: Lerne, zu vertrauen (leicht gesagt – aber wie?)
Nicht zu reden, kostet mich Kraft und Überwindung. Immer wieder der Impuls, jemanden anzurufen, jemandem zu schreiben, irgendwas. Stattdessen bin ich schon vormittags müde. Mehr und mehr merke ich, was von mir selbst übrigbleibt, wenn rund um mich nichts passiert – nämlich: Erschöpfung, Nachdenklichkeit, Sehnsucht. Eine tiefe Sehnsucht nach innerer Klarheit, aber auch danach, besser für mich zu sorgen. So vieles mache ich im Alltag durch oberflächliche Gesten wett – statt mich mir selbst zuzuwenden, verliere ich mich im Außen, hetze rum, zerstreue mich. Ich gehe sehr lange, sehr, sehr lange in die Natur. Ich bilde mir ein, die Bäume flüstern zu hören. Notiz an mich: Nicht irre werden!
Mehr und mehr merke ich, was von mir selbst übrigbleibt, wenn rund um mich nichts passiert – nämlich Erschöpfung, Nachdenklichkeit, Sehnsucht.
Gabriele Kuhn
Was mir heute den ganzen Tag auffällt: Wie oft ich seufze. Den ganzen Tag seufze ich, atme tief ein und laut aus – und frage mich, was aus mir raus möchte, was im Alltag nicht raus kann. Am späten Nachmittag entschließe mich, doch ein wenig zu putzen, zumindest den Staub rund um die Yogamatte. Danach nehme ich einen Stift in die Hand und weißes Papier – warte, was passiert. Ich male Kreise. Große und kleine, ineinander verschlungene, konzentrische Kreise. Unendlichkeit. Tag 2 ist gegen Abend von einer tiefen Trauer geprägt – ich denke an meine viel zu früh verstorbenen Eltern und was ich ihnen gerne gesagt hätte.
Notiz an mich: Taschentücher, Taschentücher, Taschentücher!
Lektüre zum Tag, diesmal aus „Das Zen-Buch vom Leben und Sterben“ von Philip Kapleau, dem Zen-Meister: „Im Altertum nahm man an, die Seele finde nach dem Tod im Grabmal oder im Sarg des Verstorbenen ihre Bleibe, sie verweile entweder im Grab oder in dessen Nähe. In ihrer Weisheit versuchen die Meister jedoch nicht, diese Dinge in Worte zu fassen oder zu erklären. Warum tun sie das nicht? In einem alten Lied heißt es: Narren geben Erklärungen, weise Menschen unternehmen nie diesen Versuch.“
Es ist dunkel, ich gehe sehr früh schlafen, nachdem ich 50 Kniebeugen gemacht und danach heiß geduscht habe.
Tag 3: Gibt es einen Seelen-Kater?
Ich wache frischer auf als zuletzt. Ich habe allerdings ein bisschen das Gefühl von seelischem Muskelkater. Da wieder – der Handyimpuls. Ich gebe ihm nach, weil es mich beruhigt. Ein paar Mails, die ich sonst sofort beantwortet habe. Heute jedoch sage ich mir: Dafür ist auch noch morgen Zeit! Zwei WhatsApp-Nachrichten von Freundinnen: Geht’s dir eh gut? Sicherheitshalber schreibe ich kurz zurück: Ja alles bestens. Und schicke ein Sonnen-Emoji dazu. Dann schalte ich das Smartphone wieder ab.
Ich bereite mir Polenta zu, süß, mit Beeren drin. Das Rühren des Breis beruhigt mich, die Süße des Gerichts ebenso.
Zwei WhatsApp-Nachrichten von Freundinnen Geht’s dir eh gut?

Bild: Maria Tenevaag/Unsplash
Danach überlege ich, was ich tun könnte. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass in Schweigeseminaren auch gearbeitet wird – man hackt Holz, arbeitet im Garten, und so weiter. Gartenarbeit steht gerade nicht an und das Holzhacken, wo auch immer, würde ich auch nicht riskieren. Ich darf ja nicht einmal „Autsch“ oder „Scheiße“ sagen, wenn ich mich verletze. Stattdessen setze ich mich hin und fange an, ein Bild zu malen – mit alten Acrylfarben, die zwar teilweise schon vertrocknet sind, aber ein bissl was geht noch.
Am Ende ist ein Bild entstanden, das aussieht wie eine große blaue Welle, in vielen verschiedenen Blautönen. Notiz an mich: Morgen googeln, wofür blau steht. (Für Ruhe, Stille, Entspannung, Gelassenheit, Sehnsucht, Freiheit, Ferne. Und Ewigkeit, wie ich anderntags erfahre.)
Resümee: ruhiger, freudiger, empfindsamer
Zeit für ein Resümee: Habe ich mich an das Schweigen gewöhnt? Ein bisschen. Ja. Kann ich locker sagen, denn bald ist es ja wieder vorüber. Es erstaunt mich aber, wie viele Fragen sich in mir aufgetan haben, in diesen vielen stillen Sekunden, Minuten, Stunden. Fragen, die die Ecken und Winkel meines Seins und meiner Seele betreffen, die ich schon lange nicht mehr besucht habe und vermutlich so verstaubt sind wie der Holzboden rund um meine Yogamatte. Sie haben sich gut versteckt, hinter dem täglichen Tun und Geplapper. Jetzt kann ich sie sehen und spüren. Ich nehme Kuli und Papier – und schreibe alles auf. Die Notiz an mich ist diesmal sehr lange. Sie endet mit einem Danke! Und zwar an mich selbst.
Habe ich mich an das Schweigen gewöhnt? Ein bisschen. Ja.

Bild: Tobi Feder/Unsplash
Der Gedankenstrom hat sich verlangsamt, ich selbst bin langsamer geworden. Ich lasse mich mehr, kämpfe nicht gegen das, was in mir passiert und sich zeigt. Am Ende meines letzten Schweigetages bin ich nicht nur stolz, „es“ getan zu haben, sondern ruhiger, freudiger, auf eine spezielle Weise empfindsamer. Auch „körperlicher“, in dem Sinn, als ich mehr in meiner Haut stecke, statt mich in meinem Gedanken-Wolkenkuckucksheim zu verlieren.
Sagen wir so, am Ende meiner Schweigetage habe ich mehr Boden unter den Füßen.
Sagen wir so, am Ende meiner Schweigetage habe ich mehr Boden unter den Füßen. Vor allem aber eine unbändige Lust, am nächsten Morgen der halben Welt zu erzählen, was alles passiert ist.
Notiz an die Leser
Allein zu schweigen, kann interessant sein, ist aber eine Herausforderung. Gemeinsam geht’s vielleicht besser. Heute gibt es sogar eigene Meditationsreisen, Schweigeseminare, in Klöstern oder im „Haus der Stille“, in der Steiermark.
Das Schweigen kann man täglich üben, indem du dir die Frage stellst: Ist das, was ich jetzt sagen will, wirklich wichtig und nötig? Oder rede ich nur des Sprechens willen, weil ich damit etwas mir vielleicht Unangenehmes „übermale“ oder kompensiere? Und schon halten wir öfter „die Klappe“ .
Gehe immer wieder mal allein in die Natur.
Bewege dich in deinem Atemrhythmus, ohne Musik im Ohr, lenke dich nicht ab. Ein Wald, eine Wiese sind wunderbare Orte, um nichts zu sagen, aber alles, was du brauchst, zu hören: die Stille, die Natur mit ihren Geräuschen selbst – und deine echten Gefühle.
Noch was: Probiere öfter mal, ganz allein zu essen, ohne dabei zu lesen, ins Handy oder in den Fernseher zu schauen. Bissen für Bissen, nix reden, nur essen. Auf einmal schmeckt alles anders.


