Wildnis, Wölfe und Klaus Haselböck: Ein Selbstexperiment
Vier frostige Wochen in den wilden Wäldern Wisconsins, ein archaisches Leben ohne Kontakt nach außen und moderne Hilfsmittel: Traum oder Albtraum? Autor Klaus Haselböck wollte genau das herausfinden.

Bild: Klaus Haselböck
In der Wildnis von Wisconsin konnte ich für einige Wochen ein komplett anderes Leben führen. Es war ein radikaler Verzicht, heraus aus der Komfortzone in einen freiwilligen Lockdown. Die Wildnis, das weiß ich heute, ist kein romantischer Ort. Dort Zeit zu verbringen kann aber den Blick auf unseren Alltag verändern. Obwohl ich längst wieder eine Uhr trage, in einem Bett schlafe und ein Handy nutze, hat das Einfache für mich heute einen ganz anderen Wert. Ich hetze weniger von Erlebnis zu Erlebnis, und für Abenteuer muss ich nicht unbedingt ins Flugzeug steigen. Die gehen sich seitdem auch im Wienerwald aus.

Bild: Klaus Haselböck
Was mir in der Wildnis klar geworden ist
. Wärme
Ein Feuer entzünden oder eine Hütte bauen zu können ist beim Leben in der Wildnis essenziell. Konfliktfrei in einer Gemeinschaft zu leben ist hingegen eine universell anwendbare Kunst.
. Digitale Welt
Social Media zeigt auf, was in unserem Alltag fehlt. Leben wir mit einer klaren Aufgabe in einer guten Gemeinschaft, so brauchen wir diese Ablenkung nicht.
. Nahrung
Essen hat viel mit Trost zu tun. Ohne den Stress von kopflastigen Aufgaben und mit einer positiven Grundstimmung reicht auch deutlich weniger.
. Verhaltensweisen
Es braucht den Willen und die Zeit, um eigene Muster zu erkennen und zu verändern – so etwas geht nicht an einem Wochenende. Selbst die Wochen im Wald waren nur eine kurze Etappe einer langen Reise.
. Erfahrung
Die Zusammenhänge in der Natur versteht man nur auf Basis eigener Erfahrung. Man muss selber gesehen, gerochen, gehört, gefühlt und gefroren haben, um wirklich zu wissen.

Bild: Klaus Haselböck
- Erfahrung
Wie alles begann
Das Leben mag seine Zyklen haben, aber die Suche nach Erlebnissen war immer meine innerste Konstante. So füllte ich einen ganz Schrank mit Devotionalien: Trails von Schweden bis Patagonien mit Zelt und Rucksack, dazu so mancher Berg bis hinauf auf das Matterhorn oder das Spiel, mit einem Atemzug möglichst tief zu tauchen. In der Kategorie „Höher, schneller, gefährlicher“ hatte ich über die Jahre gut abgeräumt, innere Reisen wie Zen-Meditation oder schamanische Erfahrungen ebenfalls bespielt.
Je mehr ich bekam, desto größer wurde die Sehnsucht nach dem Einfachen, nach dem reduzierten Leben in unserer reichlich komplexen Welt. Die Teaching-Drum, eine genauso kompromisslose wie feinfühlige Outdoor-Schule im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin, schien darauf die richtigen Antworten zu haben – bot diese doch eine elfmonatige Wilderness Immersion an. Also keine Seminarsituation, sondern das echte Leben in der Wildnis und an den Seen des Bundesstaates nahe der kanadischen Grenze.
Mein Erleben in der Natur war ja bislang oft an den modernen Takt angepasst rauf auf den Berg, runter und wieder zurück.
Zwar mit einer Versorgung von außen, aber sonst weit, weit weg von allem. Das rührte einiges in mir, war aber mit Familie und Job nicht zu vereinbaren. Dieser radikale System-Reset wäre zu weit gegangen. Als ich bei dieser Teaching Drum ein kürzeres Programm entdeckte, das sich in meinem Fall auf vier Wochen verdichten ließ, war ich wie elektrisiert. Mein Erleben in der Natur war ja bislang oft an den modernen Takt angepasst: rauf auf den Berg, runter und wieder zurück. Und seit uns Handys und Internet überallhin begleiten, war ich selbst am Kilimandscharo mit der Homebase in Echtzeit verbunden, also nie wirklich weg.
Die vier Wochen von November bis Dezember versprachen einen klaren Schnitt: ein ursprüngliches Dasein in den Wäldern Wisconsins, weit weg von den Annehmlichkeiten der Zivilisation und doch mit der Perspektive einer Rückkehr ins Vertraute. Genau das suchte ich.
Nach der Euphorie der Zusage fühlte sich der tatsächliche Schritt in die Ungewissheit trotzdem eigenartig an: Zuerst die eigene Familie am Flughafen zurücklassen, dann eine letzte warme Dusche im Hotel und schließlich wird gemeinsam mit den Leuten der Teaching Drum mein Gepäck stark nachsortiert. Nichts, was zu sehr an mein bisheriges Leben erinnert und damit das kommende Erlebnis mindern könnte, darf mit hinaus in die Wildnis: kein Buch, kein Handy und keine Stirnlampe. Snacks und andere Nettigkeiten sind erst gar nicht im Gespräch.
Kohlenhydrate, Nikotin, Koffein und Alkohol – so die Empfehlung der Schule – sollte man schon in den Wochen vor der Auszeit drastisch reduziert haben. Sonst erlebt man draußen den harten Entzug durch völligen Verzicht.
Was braucht man also für vier Wochen in der Wildnis?
Im Wesentlichen viel Wolle in Form von Hemden und Hosen mit Knöpfen (denn Zipper könnten einfrieren oder kaputtgehen), Haube, Fäustlinge (weil sie wärmer sind als Handschuhe), einen fetten Schlafsack, dicke Schuhe, ein Messer, eine Hacke, eine selbst gefertigte Holzschale samt Löffel, eine Bambuszahnbürste. Und schon ging’s los.
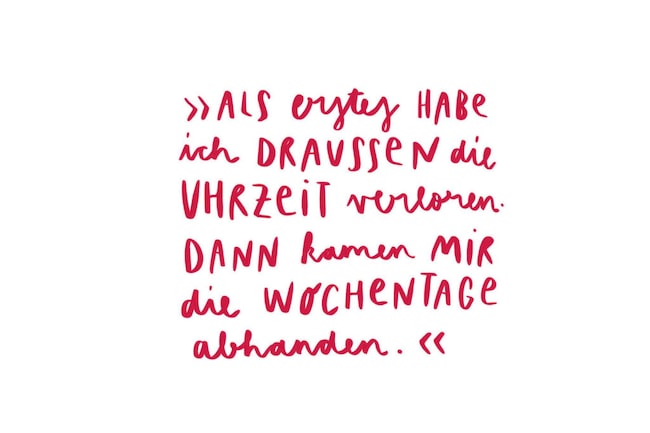
Bild: Klaus Haselböck
Woche 1
Tamarack Song , Leiter der Teaching-Drum-Schule, ist mit seinem langen weißen Bart ein moderner Gandalf. Gut siebzig Jahre seines Lebens hat er der Natur und dem möglichst wilden Leben gewidmet. Er spricht leise und bewegt sich gemessen in allem, was er tut. „Friede und Harmonie sind eine Illusion, das Leben dreht sich um Intensität“, gibt er mir mit, als er mich zum Camp bringt. Das liegt irgendwo im Nirgendwo zwischen Wäldern, Seen und Sümpfen.
Dort umarme ich acht Menschen, vier Frauen und vier Männer, die ich bislang nur über Videocalls kenne, die aber für die nächste Zeit meine Gefährten sein werden. Denn allein – das wird schnell klar – geht da draußen nichts. Gemeinschaft ist alles: Wir leben als ein Organismus, wie ein Wolfsrudel. Miteinander sammeln wir von nun an Holz, heulen im Chor, um den Clan zusammenzubringen, sind uns – ganz wie echte Wölfe – Beschützer und Ernährer. Wir spielen, lachen und streiten miteinander unter einem kalten Himmel.
Die Nacht verbringen wir in Wigwams, die wie umgedrehte, mit langen Gräsern gedeckte Brotkörbe aussehen.
Sind wir durstig, schlürfen wir das Wasser direkt aus dem großen See, teilen unsere Essensvorräte und werden gemeinsam hinausgehen, um nach Tieren auszuspähen. Die Nacht verbringen wir in Wigwams, die wie umgedrehte, mit langen Gräsern gedeckte Brotkörbe aussehen. Drinnen ist es selbst tagsüber nur düster. Auf einer Schicht Reisig und Wolldecken, die die Kälte der nackten Erde brechen, rolle ich meinen Schlafsack aus. Die kleine Behausung teile ich mit Dariya und Cedar – beide sind zuletzt den Pacific Crest Trail, die 4.000 Kilometer von Mexiko bis Kanada, gegangen, haben also den nötigen Sinn fürs Abenteuer und auch die Geduld für diese Wochen im Winterwald.
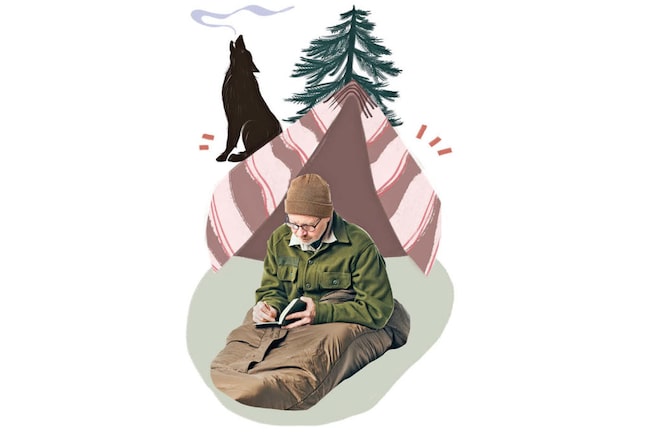
Bild: Klaus Haselböck
Dariya aus Ontario ist es dann auch, die mir am dritten Morgen, als es draußen strömend regnet und ich mich pflichteifrig aus dem Schlafsack winde, freundlich sagt: „Klaus, du weißt schon, dass wir bei Regen nicht hinausgehen?“ Meinen irritierten Blick des Mitteleuropäers, dem kein Wetter zu schlecht ist, interpretiert sie richtig und fügt schelmisch hinzu: „Wo sollten wir uns denn trocknen? Wir warten, bis es aufhört zu regnen.“

Wie gewinnt man (neue) Lust am Laufen?
Für viele ist Laufen eher lästig als lustvoll. Wie kommt das? Lauf- und Mental-Coach Florian Reiter verrät seine Motivationstricks. Weiterlesen...
Stimmt, die Gore-Tex-Jacke war nicht Teil der Packliste, und es gibt auch keinen Kasten voller Wechselbekleidung. Sehr wohl haben wir schwarze Walnüsse, die typisch für Nordamerika und sehr hart im Nehmen sind. Zumindest wenn man ihre Schale mit einem Stein knacken möchte. An diesem Tag werden sie, da der Regen erst in der Dämmerung endet, auch unsere einzige Mahlzeit sein.
Woche 2
Das Erste, was ich draußen verloren habe, war die exakte Uhrzeit. Wenig später kamen mir die Wochentage abhanden. Beides hat dort keine Bedeutung. Ohne Uhr gibt es keine Termine, ohne Handy weder Anrufe und Whats-App-Nachrichten noch Facebook-Posts: Die Sonne reicht als Orientierung. Ist es hell, kommen wir aus den Wigwams, knacken möglichst geschickt die Walnüsse, gehen zum See trinken, und der Tag beginnt. Bekommen haben wir hingegen neue Namen: „Das ist die bedeutendste Maßnahme, die ihr in eurer Entwicklung setzen könnt“, sagt Tamarack Song, der auch nicht als solcher auf die Welt gekommen ist und uns alle paar Tage auf kurze Gespräche besucht.
Er und seine Guides sind unser einziger Kontakt in der Wildnis zur Außenwelt. Was sich dort inzwischen tut, sagen sie uns natürlich nicht. Wir leben in einem archaischen Kosmos, wir sollen im Moment aufgehen. Die Änderung unserer Namen hilft, dass wir uns vom Bisherigen lösen. Genauso sollen wir auf hören, die Tage zu zählen, um uns in die neue Wirklichkeit einzuleben.

Bild: Klaus Haselböck
Als „Wintergreen“, weil ich als Letzter zur Gruppe kam und eine neue Frische hineingebracht habe, helfe ich beim Bau einer Hütte samt Feuerstelle mit: Gemeinsam lassen wir diese aus Stöcken, die wir in die Erde rammen, und Rindenpaneelen, die daran mit Wurzeln festgezurrt werden, entstehen. Getrocknetes Moos dient als Isolation. Als Quartier für uns wäre sie viel zu komfortabel, passt also nicht zur Idee dieser Wochen im Wald. Vielmehr dient ihr Bau dazu, uns als Gruppe zu festigen, zusammenzufinden, Lösungen auszutüfteln, ein gemeinsames Projekt zu haben.
„Lasst die Erwartungen gehen, nur das Tun zählt“, empfiehlt uns Tamarack, wenn wieder einmal die Emotionen hochkochen, die Argumente herumfliegen und die Stimmung am Kippen ist. Um genau das zu lernen, sind wir hier. Wie es sich anfühlt, wertschätzend als Rudel zu leben, ist eine Erfahrung, die weit über die Wildnis hinausreicht. Deutlich einfacher sollte es da schon mit der Hygiene sein: Die liegt nämlich völlig in der eigenen Verantwortung.
Meine anfangs überschießenden Ambitionen vom Eisbaden im Wim-Hof-Stil habe ich in den Wäldern sehr schnell sein lassen.
Das Wechseln der Wäsche ist dann auch ein guter Moment, gleich den ganzen Körper mit einem feuchten Waschlappen – ein letztes Relikt der Zivilisation – abzureiben. Bei der ohnehin permanent nagenden Kälte braucht es für das kleine Plus an Sauberkeit schon einiges an Überwindung. Und zu stark geschwitzt hat dort eh noch niemand. Apropos: Meine anfangs überschießenden Ambitionen vom Eisbaden im Wim-Hof-Stil habe ich in den Wäldern sehr schnell sein lassen.
Wenn die nächste heiße Dusche mehr als einige Wochen entfernt ist, setzt man kein Quäntchen an Wärme aufs Spiel.
Woche 3
Eines Morgens bleibt es dunkel im Wigwam, obwohl es längst hell sein müsste: Die niedrigen Eingänge, durch die wir in jedem Fall nur kriechend ins Freie kommen, sind fast völlig zugeschneit. Bodenfrost und damit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt hatten uns ja schon länger begleitet. Mit dem Schnee, der jetzt als großes weißes Leintuch über der Landschaft liegt, werden plötzlich die Wege der Tiere auch für das ungeübte Auge sichtbar – Wölfe, Marder, Füchse und vor allem Hirsche.

Bild: Klaus Haselböck
In kleinen Gruppen waren wir schon zuvor unterwegs, um nach Spuren auszuspähen. Wir wollen eine Vorstellung davon bekommen, wer da sonst noch in den Wäldern unterwegs ist, welche Dramen sich vielleicht abgespielt haben. Der Schnee erleichtert es uns jetzt, deren Fährten zu folgen, die Geschwindigkeit und die Intention der Tiere in ihren Spuren zu sehen, ihre Erregung zu spüren und ihnen oft über Kilometer durch die topfebenen Wälder und über gefrorene Seen hinweg zu folgen. Nun ist auch die Orientierung weniger knifflig.
GPS, Karte oder einen Kompass haben wir nicht zur Verfügung, und die Sonne versteckt sich meist hinter einem diesigen Himmel. Die Verantwortung, wenn wir weit weg vom Camp sind, liegt ganz bei uns: achtsam mit uns selbst zu sein, die Landschaft verstehen zu lernen und nach Stunden der Begeisterung für eine Spur auch die eigene wieder zu finden, um zum Lager zurückzukehren. Alle paar Tage erhalten wir von den Guides der Teaching Drum Nahrungsmittel: Äpfel und Avocados hängen wir – in Tüchern eingebunden – in Bäume, um sie vor Nahrungskonkurrenten aus dem Wald zu schützen.
Joe aus New Jersey, der ein ganzes Jahr hier draußen verbringt, ist der Geübteste des Packs mit dem Feuerbogen.
Tagsüber enteisen wir sie dann in unseren Wollhemden, ehe wir sie als Snacks verspeisen. Die andere Verpflegung verstecken wir unter Steinen in Erdlöchern. Die einzige warme Mahlzeit des Tages kochen wir am Abend. Sie hält unseren Motor am Laufen. Joe aus New Jersey, der ein ganzes Jahr hier draußen verbringt, ist der Geübteste des Packs mit dem Feuerbogen. Meist sorgt er für die Glut. Dann dünsten wir Süßkartoffeln, Kürbis sowie ganze Krautköpfe und legen Fische auf die heißen Steine. Sie sind eine wichtige Proteinquelle und selbst deren Gräten noch begehrte Tauschware.
Wir halten uns an den Händen, danken für den Tag, ehe die Holzschalen reihum gehen. Philipp aus Kärnten füllt sie mit groben Stücken Gemüse und übergießt diese noch mit zerlassenem Fett. Jede Kalorie ist kostbar. Während des Essens drücken wir unsere Schultern aneinander, um ja nichts von der Wärme des Feuers hinaus in die Winternacht entkommen zu lassen. Sind die Mägen voll, ist es an der Zeit, Geschichten zu erzählen. Im Kino unter Sternen wird der Tag nochmals lebendig: wer die aufregendsten Spuren gefunden hat, welche Geschehnisse sich dahinter vermuten lassen und, vor allem, wo wir morgen unterwegs sein werden.

Ein Wald für Leser
Das finden wir schön: Die Kollegen vom Terra Mater Magazin pflanzen einen Wald. Weiterlesen...
Woche 4 in der Wildnis
Selten habe ich in meinem Leben mehr geschlafen als in den Wäldern Wisconsins: Gefühlte zehn Stunden schlummere ich jede Nacht im perfekten Dunkel des halbkugelförmigen Kokons. Dank der ungetrübten Ruhe kommen die Träume in einer nie gekannten Kraft und Regelmäßigkeit zu mir. Da wir als Wolfsrudel symbiotisch miteinander leben, hat der Traum eines jeden Einzelnen auch für den anderen Bedeutung. Nach der Tradition der Natives, in der wir von Tamarack unterrichtet werden, begegnen wir nächtens ohnehin nur uns selbst.

Bild: Klaus Haselböck
Je mehr wir aber Klarheit über uns haben, desto stärker wird der Clan. Genauso kommen wir tagsüber, den Fährten der Tiere folgend, auch uns selbst auf die Spur: Wohin führt uns unser Leben? Was wird unser nächster Schritt? „Sind wir hier draußen nicht Teil einer großen Zen-Story?“, frage ich Tamarack, der ein Faible für diese symbolhaften Geschichten aus Asien hat. „Manche verstehen den Sinn, manche nicht“, murmelt er in sich hinein.
Selten war mein Leben so verdichtet, so am Punkt, meine Gedanken so klar und ich so in Kontakt mit mir selbst.
Sein Unterrichtsstil ist nie frontal, sondern wendet sich an Seekers, an „Suchende“, wie er die Teilnehmer seiner Kurse in dieser unsagbar schönen Wildnis nennt, an Menschen, die bereit sind, als Frage zu leben. Für sie ist die Natur ein großes Klassenzimmer, wo stets über die Erfahrung gelernt wird. Ich gewöhne mich an manches, vermisse anderes. Auf angenehme, fast euphorische Phasen folgen Momente der Trauer, des Schmerzes oder großer Langeweile. Intensiv ist es hingegen immer, selten war mein Leben so verdichtet, so am Punkt, meine Gedanken so klar und ich so in Kontakt mit mir selbst.
Und nach täglichem Probieren mit der schwarzen Walnuss, nach all der morgendlichen Praxis finde ich auch heraus, dass es der gleichgültige Schlag ist, der sie am besten bricht. „Loslassen, nicht anhaften“ ist die Botschaft der Natur. Irgendwann weiß ich dann auch: Es ist genug. Was es zu lernen gegeben hat, habe ich gelernt. Es ist Zeit, aus der Wildnis nach Hause zurückzukehren.


