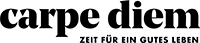Me-Time: Warum Selbstfürsorge so wichtig ist
Eine Ode an die Me-Time – oder warum wir bewusst Zeit mit uns selbst verbringen sollten.

Adobe Stock | Tatyana
Beziehungen wollen gepflegt sein, wir wissen das. Und so nehmen wir uns Zeit: Zeit für Freunde, Zeit für die Familie, Zeit für die Partnerschaft. Darüber hinaus buchen wir von unserem Zeitkonto so einiges an Zeit für den Beruf ab.
Pflichtbewusst beantworten wir Anrufe, E-Mails, nehmen Termine wahr. Und bald schon nähert sich das Zeitkonto seinem Limit. Viel Zeit bleibt nicht. Schon gar nicht dafür, sich selbst zu fragen, was wir andere Personen mehrmals täglich fragen: Wie geht’s dir?

Mehr Me-Time – ein Selbstversuch in 4 Wochen
„Nimm dir doch mal Zeit nur für dich selbst! Das ist echt wichtig. Wirst sehen, das tut dir soooo gut!“ – Wirklich? Und wer macht dann alles andere? Autorin Heidi List stellt sich der Herausforderung Me‑Time. Weiterlesen...
Was bedeutet Me-Time wirklich?
Blöde Frage? Weil man ja sowieso spürt, wie es einem selbst geht? Jein. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, das heißt in erster Linie: auf sich zu hören, auf sich zu achten. Und dazu zählt: herauszufinden, was einem guttut. Lieb zu sich zu sein, wenn man so will.
Dabei stellt sich heraus, dass uns oftmals gar nicht so wirklich bewusst ist, wie genau wir uns eigentlich fühlen und wie es uns geht. Me-Time meint weniger das Abhängen am Sofa vor Netflix – wiewohl, um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen, auch das ganz großartig und wohltuend sein kann –, sondern das bewusste Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit.
Wie fühle ich mich?
Was brauche ich?
Fehlt mir etwas?
Worum kreisen meine Gedanken?
Es geht weniger darum, etwas ganz Konkretes zu tun, als überhaupt etwas zu tun. Nämlich: innezuhalten.

Me-Time: Tu dir selbst Gutes
Heute nehmen wir uns keine Zeit für andere, wie sonst so oft. Sondern schaufeln Zeit für uns selbst frei: Me-Time ist das Motto der Stunde. Du bist mit dabei? Dann bitte hier entlang. Weiterlesen...
10 Minuten bewusste Pause
Die Me-Time sollte man sich nicht abquälen, irgendwo zwischen 10-Uhr-Termin, Lunch mit der Mutter, Abgabe am Nachmittag und Cocktail-Hour mit den Mädels. Quantität ist mit Blick auf die Me-Time gar nicht wesentlich. Es ist – wie so oft – die Qualität, die entscheidend ist.
Tatsächlich sind zehn bewusst genutzte Minuten völlig ausreichend. „Bewusst“ ist ein Schlüsselwort. Wissenschaftliche Studien belegen den positiven Effekt: Achtsamkeitsübungen schaffen neurowissenschaftlich nachvollziehbare – selbstverständlich: positive – Veränderungen im Gehirn.
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Forschungs- und Studienergebnissen, die das belegen. Falls du mehr darüber lesen willst, gute Quellen sind diese Studie von Harvard-Forschern rund um Dr. James E. Stahl oder die Analyse von Oxford-Senior Research Fellow Dr. Catherine Crane.
Man muss nicht meditieren, um seine Aufmerksamkeit zu bündeln.
Der positive Effekt von Me-Time
Na gut. Die vielbeschworene Achtsamkeit mag auf den ersten Blick Bilder meditierender Klangschalen-Yogis heraufbeschwören. Wer damit nichts anfängt, sollte einen zweiten Blick riskieren. Man muss nicht meditieren, um seine Aufmerksamkeit zu bündeln – oder, wie es im Fachjargon genannt wird: um zu „zentrieren“ und zu „fokussieren“. Es ist nachweislich so, dass Achtsamkeitsübungen stimmungserhellend wirken und Angsterkrankungen sowie Depressionen lindern.
Um den wissenschaftlich belegten Effekt von Achtsamkeitsübungen für sich nutzen zu können, bedarf es eines Zustands der Kontemplation. Was das heißt? Seine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu bündeln. Und das geht eigentlich recht einfach.

Gelassenheit lernen mit der Teemeditation
„Abwarten und Tee trinken“ ist mehr als nur ein Sprichwort, wenn es darum geht, deinen Zorn nicht deine Taten bestimmen zu lassen. Weiterlesen...
Beobachten, nicht bewerten
Wer sich zehn Minuten am Tag Zeit nimmt, um zu sitzen, die Augen zu schließen, ruhig zu atmen und loszulassen, hat die Mission bereits erfüllt. Tatsächlich geht es bei Achtsamkeitsübungen in erster Linie darum, ausnahmsweise einmal weniger zu tun als sonst. Also nicht wieder etwas zu leisten, zu bewerten oder sich mit den drei simultan laufenden Filmen im körpereigenen Kopfkino zu identifizieren.
Die Me-Time sollte eine wohltuende Pause von alledem sein: Hier darf alles sein – außer: Zwang. Viele mögen instinktiv meinen, es ginge darum, gar nicht mehr zu denken – die Kopfkinofilme anzuhalten, alle Gedanken irgendwie auszumerzen. Falsch. Alles darf passieren, Gedanken dürfen sein, Filme dürfen laufen.
Das Einzige, was es zu leisten gilt, ist diese Dinge zu registrieren, also bewusst wahrzunehmen. Ob es die Geräusche um einen herum sind, die eigenen Gedanken oder Gefühle im Körper. Nichts wird bewertet, nur beobachtet und registriert. Man sollte sich also nicht grollen, wenn die Gedanken wieder einmal davongaloppieren und sich in einer Endlosspirale aus Grübeleien verfangen.
Man stellt einfach fest: Aha, diesen Film sehe ich wieder. Okay, jetzt denke ich an die E-Mail, die ich noch schreiben muss. Ah, und jetzt an den Termin morgen.

So schaffst du im Urlaub neue Gewohnheiten
Auch dein Körper freut sich im Urlaub darauf, andere Bewegungsimpulse zu bekommen als die üblichen. Was man jetzt lieb gewinnt, bleibt oft auch im Alltag als Gewohnheit erhalten. Weiterlesen...
Regelmäßigkeit hilft
Man kann das ja einfach einmal probieren. Feste Gewohnheiten helfen dabei, die Me-Time im Alltag zu institutionalisieren. Man kann sich zum Beispiel morgens nach dem Kaffee die Zeit dafür nehmen – etwa statt des Social-Media-Updates – oder abends im Bett, nach (oder statt) der neuesten Folge der Netflix-Serie.
Wer sich die Me-Time erst einmal antrainiert hat, wird sie irgendwann auch nicht mehr hinterfragen – genauso wenig wie den täglichen Griff zur Zahnbürste. Das Extrazuckerl für diese Anstrengung, die eigentlich keine ist: Man pflegt das, was einen bis an sein Lebensende begleitet. Die Verbindung zu sich selbst.

Sarah Desai: „Atmen ist eine Pause von dir selber“
70.000 Gedanken rasen täglich durchs menschliche Gehirn. Sarah Desai, Autorin, Coach und Podcasterin, bändigt sie – mit Meditation und Mitgefühl. Ein Interview. Weiterlesen...