Wie man aus seiner Lebenszeit mehr macht, indem man weniger macht
Im Durchschnitt haben wir 39 Millionen Lebensminuten zur Verfügung. Jede davon ist einmalig. Jede davon ist unwiederbringlich. Und jede davon bietet uns die Chance, mit Leben und Erleben, mit Freude und Sinn erfüllt zu werden.

Bild: Marina Munn
- Was machst du mit deiner Lebenszeit?
- Warum vergeht die Zeit schneller
- Der Urlaubseffekt
- Kind im Moment
- Meine Lebenszeit gestalten
- Wie sich die Zeit anfühlt
- Wie geht’s mir heute?
- „Zeitforscher“ ... so was gibt’s? Was macht denn der?
- ... und wann ist die beste Zeit zum Essen?
- Eule oder Lerche?
- Wie finde ich meinen Rhythmus?
- Der gezogene Zahn der Zeit
- Wenn das Herz tanzt
- Mehr Flexibilität
- Raus in die Natur!
- Zum Abschluss noch ein Dialog aus „Momo“: etwas zum Nachdenken und um ein bisschen unsere Lebenszeit anzuhalten.
Was machst du mit deiner Lebenszeit?
Nützt du sie? Erfüllst du sie? Lässt du sie vergehen, vor sich hin plätschern? Vertreibst du sie dir gar? Finde es heraus! Schreib einen Tag lang auf, was du mit deiner Lebenszeit anstellst – und schenk dir dadurch einen neuen Blick auf deine Möglichkeiten. ... und? 53 Minuten auf Instagram verbracht? Oder den duftenden Kuchen gebacken, den du schon lange machen wolltest? Ein gutes Buch gelesen? Viel zu lange auf einen Rückruf gewartet?
Wir verbringen unsere Lebenszeit mit den unterschiedlichsten Dingen – mal schönen, mal unerwünschten. Selten durchleben wir sie bewusst. Doch sobald wir wissen, womit wir unsere Lebenszeit eigentlich verbringen, lässt sich die Balance Schritt für Schritt zugunsten der schönen Dinge verschieben.
Warum vergeht die Zeit schneller, je älter wir werden?

Bild: Marina Munn
Weil wir uns in Routinen gemütlich eingerichtet haben. Weil wir verlernt haben, uns wie die Kinder an Neuem zu erfreuen. Aber das können wir ändern – und manches davon ändert sich auch ganz von selbst. Mit der Zeit.
Babys kennen keine Zeit. Kinder vergessen sie über ihrem Spiel. Erwachsene hingegen hadern mit ihr. Wir beklagen, dass sie zu schnell vergeht – und ertragen dennoch keinen Moment des Stillstands. Sieben Minuten an einer Bushaltestelle zu warten erscheint uns als Ewigkeit, während wir verwundert feststellen, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist. Warum ist das so? Was geschieht mit uns, wenn wir älter werden? Werden die Stunden wirklich kürzer? Marc Wittmann hat die Antwort. „Es ist die Routine“, sagt er. „Sie ist unser größter Zeitfresser.“ Denn mit den Jahren, erklärt der Forscher vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, werden wir routinierter in den Dingen des Alltags: „Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie man eine Straße quert. Wir tun es einfach. Und weil es keine große Sache ist, speichern wir es auch nicht extra im Gedächtnis ab. Wer will sich schon an jede Ampelphase der letzten zehn Jahre erinnern?“
Unsere Wahrnehmung der Zeit ist eine Funktion des Gedächtnisses. „Bei rückblickenden Zeitintervallen – dem letzten Jahr, der letzten Woche, dem vergangenen Tag – geht es immer um Gedächtnisinhalte. Sie definieren die gefühlte Zeit“, sagt Wittmann. „Klar ist daher: Je abwechslungsreicher ich mein Leben gestalte, desto weniger schnell scheint es zu verfliegen. Weil ich mehr davon im Gedächtnis speichere.“
Der Urlaubseffekt
Ein Beispiel für den Zeitfresser Routine ist der typische Urlaubseffekt: Die ersten Urlaubstage im All-in-Resort auf Teneriffa wirken unendlich lang. Alles ist neu, vieles zu entdecken, daher wird es auch mit einer Extraportion Gedächtnisleistung gespeichert. Gegen Ende des Urlaubs scheint die Zeit jedoch wieder schneller zu vergehen. Schlichtweg weil man inzwischen weiß, wo die Toilette ist und wie der Sangria schmeckt. Auch im Urlaub schleicht sich Versiertheit – und ihre verwünschte Schwester, die Routine – ein, und zwar unweigerlich. Je neugieriger und wacher ich meine Umgebung wahrnehme, desto länger kann ich das Einschleichen hintanhalten, verhindern lässt es sich aber nicht. Routine ist der Preis, den wir für unsere Lebenserfahrung zahlen.
Kind im Moment
Im Umkehrschluss müsste das bedeuten: Keine Lebenserfahrung zu haben ist gleichzusetzen mit ungehemmtem Abtauchen und Aufgehen in unserer Lebenszeit. Gewissermaßen stimmt das auch. Man kann das gut bei Kindern beobachten. Sie nehmen die Zeit jenseits des erlebten Moments schlicht nicht wahr. Da kann die Mama noch so oft rufen „Essen kommen!“, das Kind wird „Gleich!“ antworten – und in derselben Sekunde nichts mehr davon wissen.
Für in der Gegenwart Versunkene ist Zukunft ein abstraktes Konzept. Auch dann, wenn sie die unmittelbare Zukunft ist und Spaghetti beinhaltet. Selbstkontrolle? Zeitgefühl? Das ist im menschlichen Leben nicht vorgesehen – zumindest bis zur Einschulung nicht. Denn das Einschätzen von Zeitabläufen ist eine Kulturtechnik, die mit unserer Sprachentwicklung und mit abstraktem Denken zu tun hat.
Um Zeitgefühl zu entwickeln, muss man Erfahrungen sammeln. Man muss erleben, was gewisse Intervalle bedeuten: Wie viele Gummibärchen kann ich in einer Minute essen? Und wie viele Legotürme in einer Stunde bauen und wieder umwerfen? Dauert das Bauen länger als das Umwerfen? Als Erwachsene haben wir das längst internalisiert (wenn auch längst nicht alles, denn sonst würden wir nie zu spät kommen). Außerdem sind Zeitbegriffe sprachlich kodiert: Was sind eine Million Jahre? Was sind fünfzig Jahre? Beides empfinden wir als „lange her“, und trotzdem gab es in Omas Kindheit keine Dinosaurier mehr. Um das erfassen zu können, brauchen wir abstraktes Denken und die Fähigkeit, Zeiträume zu visualisieren.
Meine Lebenszeit gestalten

Bild: Marina Munn
Beginnt also die Lebenszeit zu rasen, sobald wir sie einteilen und benennen können? Nein, sagt Wittmann. „Auch für junge Erwachsene ist noch alles neu: Das erste Mal ohne Eltern im Ausland, das erste Semester an der Universität ... Kein Wunder, dass die erinnerte Zeit länger wirkt. Das verliert sich unweigerlich mit den Lebensjahren, was aber nicht heißt, dass man nichts tun kann!“
Und das geht sogar ganz einfach: Wer am Wochenende nicht vor Netflix versumpft, sondern einen Ausflug ins Unbekannte wagt, dem kommen die beiden Tage deutlich länger vor. Die andere gute Nachricht: Irgendwann ist auf natürliche Weise Schluss mit der Beschleunigung. Etwa bis sechzig, so zeigen Wittmanns Forschungen, wird die Zeit kürzer, danach pendelt sich diese Wahrnehmung ein. Im Alter sinkt der Takt unseres Zeitgefühls wieder.
Im Alter sinkt der Takt unseres Zeitgefühls wieder.
Wie sich die Zeit anfühlt
Wo spüren wir die Zeit? Gibt es ein Sinnesorgan für die Zeit? Ist es gar das Herz, wie Michael Ende in seinem berühmten Märchenroman „Momo“ so poetisch meint? „Zeit ist Leben“, heißt es dort. „Und das Leben wohnt im Herzen.“
„Die Zeit ist überall“, sagt Wittmann, „es gibt nichts im Körper, was nicht der Zeit unterworfen ist. Wir haben zwar kein eigenes Sinnesorgan für die Zeit – wie wir Augen fürs Sehen oder Ohren zum Hören haben –, dennoch haben wir ein Gefühl für ihren Verlauf. Wir spüren, ob die Zeit gerade langsam vergeht oder fliegt.“ Die sogenannte Schrecksekunde nehmen wir überhaupt in jeder Körperfaser wahr. Wittmann vermutet, dass wir die Zeit über unsere Tiefensensibilität erfassen, über die Eigenwahrnehmung des Körpers. Die damit wahrgenommenen Signale gelangen ins Gehirn und werden in der zuständigen Hirnregion, der Insula, verarbeitet – ebenso wie die anderen Impulse der Körpereigenwahrnehmung: Ist uns kalt? Heiß? Juckt’s? „Zeitempfinden ist Körperempfinden“, sagt Wittmann. „Weil wir einen Körper haben, verstehen wir die Zeit.“
Wie geht’s mir heute?
Die Verknüpfung lässt sich auch umgekehrt deuten: Über meine Körperwahrnehmung kann ich meine Zeitwahrnehmung steuern. Wenn das stimmt, haben wir tatsächlich selbst in der Hand, wie intensiv wir unsere Lebenszeit wahrnehmen. Indem wir zum Beispiel beim nächsten Mal an der Bushaltestelle das Handy einfach in der Tasche lassen. Stattdessen rein- und nachspüren: Wie geht es mir gerade? Ist da ein Ziehen im Rücken? Bin ich heute grantig? Und wieso?
Wenn wir uns selbst wieder bemerken, wenn wir uns nicht ablenken lassen, sondern hinschauen, passiert nämlich noch etwas anderes: Wir brechen aus der Routine aus, ganz nebenbei, ohne großen Aufwand – und unsere gefühlte Lebenszeit läuft für uns dadurch ein bisserl langsamer ...
„Zeitforscher“ ... so was gibt’s? Was macht denn der?
„Ich beobachte Menschen, wie sie mit Zeit umgehen“, sagt Jonas Geißler. Er ist Zeitforscher. „Ich denke darüber nach, warum sie das genau so tun und nicht anders – und was sie doch anders machen könnten. Und manchmal muss ich schmunzeln.“
Worüber müssen Sie denn schmunzeln?
„Zum Beispiel am Freitagnachmittag, wenn ich den Flieger nehme, mit dem viele Manager von Düsseldorf nach München heimfliegen: Da wird der Flughafen zur Bühne für ein Theaterstück der Gehetzten und der Entfremdeten, die mit Koffern bewaffnet auf und ab gehen und in ihre Geräte schreien oder tippen.“
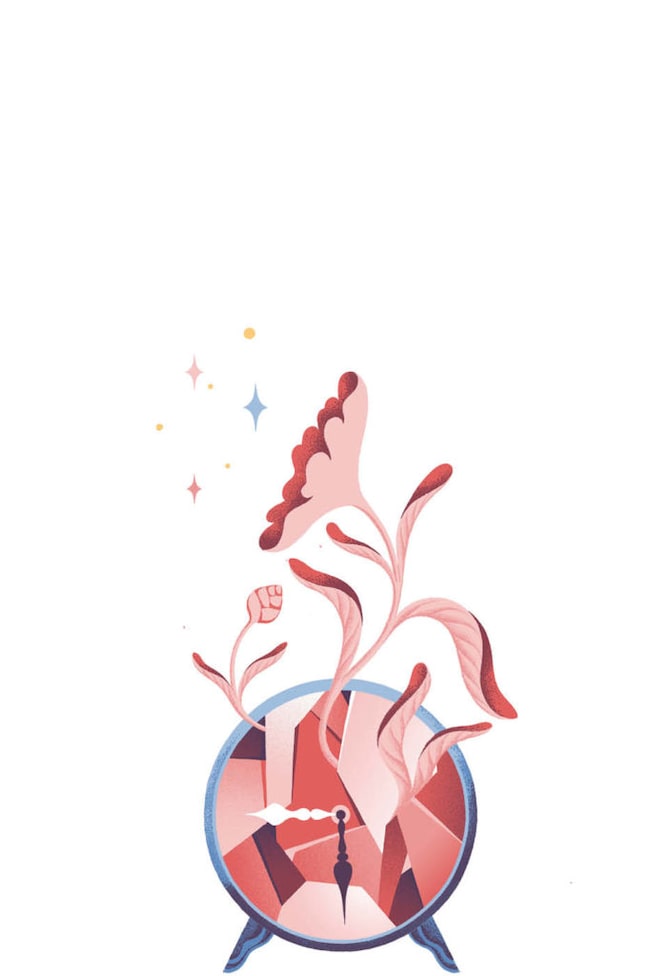
Bild: Marina Munn
Sind diese Manager nicht einfach nur ein Symbol dafür, dass wir als Gesellschaft zu schnell leben?
„Ja. Wir sind zu schnell geworden. Ich merke in meinen Seminaren, wie sehr immer mehr Menschen unter dem hoch getakteten Tempo unserer Gesellschaft leiden. Sie fühlen sich in ihrem Leben fremd, empfinden sogar so etwas wie Sinnentleerung. Das kann bis zu Belastungserkrankungen führen – sogar bis zum Burnout.
Unsere Tage haben dieselben 24 Stunden wie vor tausenden Jahren. Wieso kommt es uns so vor, als würden sie viel zu schnell vergehen? „Das ist relativ einfach erklärt: Noch nie in der Menschheitsgeschichte waren wir so reich. Und zwar so reich an Gütern und so reich an Möglichkeiten, unsere Zeit zu nützen.“
Sie meinen, unser Wohlstand macht uns Stress? Ganz viele Dinge helfen uns doch, im Alltag Lebenszeit zu sparen. Früher kostete Wäschewaschen einen halben Tag, jetzt ist es ein Knopfdruck.
„Jedes Gerät für sich mag Zeit sparen, natürlich. Aber das Entscheidende ist etwas anderes: Vor hundert Jahren gab es in einem Haushalt ungefähr vierhundert Gegenstände. Heute sind es im Durchschnitt zehntausend. Sie alle verlangen unsere Aufmerksamkeit. Sie wollen verwendet, verstaut, gewartet, gereinigt, repariert, entsorgt werden. Und damit bringen sie uns auch Stress, weil wir ständig über den Einsatz unserer Zeit entscheiden müssen: Was mache ich zuerst, was lasse ich warten? Worauf konzentriere ich mich, was lasse ich sein?“
Müssen wir nicht einfach akzeptieren, dass die moderne Zeit nach Multitasking-Fähigkeiten verlangt?
„Da gibt es einen Haken: Unser Gehirn ist nicht auf Multitasking ausgerichtet. Es kann nur eine Sache nach der anderen machen, nicht mehrere zugleich. Was wir als Multitasking verstehen – oder besser gesagt missverstehen –, ist der blitzschnelle, sprunghafte Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufgaben. Und an den gewöhnt sich das Gehirn.
Das heißt, ich kann mein Gehirn darauf trainieren, im Alltag zumindest so etwas Ähnliches wie Multitasking zu schaffen? Das klingt nach einer gar nicht so schlechten Nachricht.
„Nun ja, das Gehirn ist immer ein Protokoll seiner Benutzung.“
Was meinen Sie damit?
„Was Sie mit ‚Training‘ gemeint haben, funktioniert in beide Richtungen. In eine positive zum Beispiel, wenn ich ein Leben lang Geige übe. Dann prägt sich ein ganz bestimmter Bereich im Gehirn immer stärker aus. Genauso ist es im Negativen, wenn sich Menschen darauf konditionieren, immer schnell, schnell zu agieren, um viele kleine, aber eigentlich unwichtige Sachen zu machen. Das tut genauso etwas im Kopf wie Geige üben. Wenn ich mein Leben lang ständig nur – im wahrsten Sinne des Wortes, wie am Handy – weiterwische, schnell mal dort und hier und wieder weg bin, dann stellt sich im Gehirn ein bestimmtes Zeitwahrnehmungsmuster ein: kurz – kurz. Das kann man sogar im Gehirnscanner sichtbar machen. Ebenfalls messen kann man übrigens, dass unsere Aufmerksamkeitsspannen sinken. Man könnte sagen: Wir trainieren durch unseren Lebensstil systematisch unsere Aufmerksamkeitsspannen runter. Viele Menschen schaffen es gar nicht mehr, zwei, drei Stunden ein Buch zu lesen. Und hier schließt sich der Kreis. Denn wozu führt diese dauerhafte Sprunghaftigkeit in unserer Wahrnehmung der Zeit? Sie fliegt, sie verfliegt."
Und man hat das Gefühl, man hätte schon wieder zwei Stunden sinnlos vertrödelt.
„Hätten Sie sie doch wirklich vertrödelt! Das wäre nämlich eine taugliche Gegenmaßnahme zu stundenlangem Versumpfen auf Facebook. Trödeln gilt als zweckfreie Zeit – doch gerade Trödeln, gerade das Zweckfreie täte uns gut.“
Aber wie komme ich aus diesem Strudel und kann meine Lebenszeit besser managen?
Zunächst mal: Lassen Sie das mit dem Zeitmanagement sein. Es geht nicht darum, noch effizienter zu werden oder noch mehr in den Tag reinzupressen. Es geht eher um die Kraft des Seinlassens. Darum, weniger zu tun, das aber bewusster. Ums Gegensteuern, gegen einen Trend, der sogar den Schlaf oder die Entspannung produktiv nützen möchte.
Gerade Schlaf und Entspannung stehen doch für dieses Seinlassen?
„Aber nicht wenn sie als Tool eingesetzt werden. In der Achtsamkeitsmeditations-, Yoga- und Ernährungsbewegung gibt es solche Tendenzen ganz deutlich: Da werden Achtsamkeits-Apps aufs Handy geladen oder Yogakurse besucht, um noch leistungsfähiger, noch produktiver und fokussierter sein zu können. Ein Paradoxon, das mir in meiner Arbeit ständig begegnet.“
Ihre Antwort auf die Überforderung und Überfrachtung unserer Zeit lautet „Zeitkompetenz“. Zu der wollen Sie die Leute durch Ihre Vorträge und Seminare inspirieren. Was darf man sich unter diesem Begriff vorstellen?
„Ein zeitkompetenter Mensch kann sich selbst und seine Umwelt beobachten: Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie tun das andere? Was läuft dabei nicht so gut – und wichtig: Was läuft dabei gut? Dann ist es wichtig, wahrzunehmen, wo es hakt – und dass und wie es veränderbar ist. Durch Weglassen oder Abgeben.“
Durch Weglassen und Abgeben gewinnt man Lebenszeit zurück?
„Indem man nicht mehr Dinge macht, sondern weniger. Die dafür wirksamer und sinnvoller, im Sinn von ‚voller Sinn‘.“
Was fang ich mit der gewonnenen Lebenszeit an? Die Versuchung, sie wieder-
um für etwas zu nützen, ist groß.
„Sehr groß, ja. Menschen tendieren dazu, frei gewordene, gewonnene Zeit wieder mit dem theoretisch unendlich großen Berg an Dingen zu füllen, die es rund um uns gibt. Dazu kommt, dass es in unserer Gesellschaft sehr wichtig geworden ist – geradezu ein Statussymbol –, keine Zeit zu haben. Das gilt es ebenfalls zu reflektieren. Im Reflektieren liegt überhaupt der Schlüssel. Damit wird das Thema gestaltbarer: Wenn ich reflektiere, bin ich nicht mehr Opfer der Zeit, sondern die Zeit ist auf meiner Seite.“
... und wann ist die beste Zeit zum Essen?
„Wer gesund leben will, der muss sich auch gesund ernähren. Nicht nur, was die Wahl der Speisen betrifft, sondern auch, was die Zeit des Essens angeht.“ Was Kräuterpfarrer Kneipp im 19. Jahrhundert predigte, beschäftigt heute die Ernährungswissenschaft – das Zusammenspiel von Nahrungsaufnahme und Chronobiologie, von Mahl und Zeit.
Eine wichtige Rolle kommt unserem angeborenen Hungerrhythmus zu: ein Signal alle vier bis sechs Stunden, das wir nicht durch Zwischenmahlzeiten unterbinden sollten. Wer auf Snacks verzichtet, unterstützt den inneren Reinigungsprozess der Zellen. Der rein stoffwechselbasierte Ansatz empfiehlt morgens und mittags größere Portionen als abends. Zudem schüttet der Körper nach jeder Mahlzeit Insulin aus, das wiederum die Fettverbrennung hemmt. Diese sollte gerade nachts auf Hochtouren laufen.
Quellen:
Dr. Edmund Semler, Ernährungswissenschaftler, Dr. Andreas Pfeiffer, Endokrinologe
Eule oder Lerche?

Bild: Marina Munn
Ob wir frühmorgens oder spätnachts zu Höchstform auflaufen, steht in unseren Genen. Doch es gibt Tricks, die innere Uhr ein wenig umzustellen. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, heißt es. Klingt gut, aber gilt nicht für alle. Wie jemand seinen Tag erlebt, hängt vom Chronotyp ab, und dieser ist genetisch festgelegt. Von Geburt an gibt eine innere Uhr den individuellen Takt vor.
Grob werden zwei Typen unterschieden:
Die Lerche ist morgens fit, Nachtarbeit belastet sie sehr.
Die Eule hingegen ist Weltmeister im Langschlafen. Je später, desto besser kann sie sich konzentrieren und ist kreativ.
Generell gibt es mehr Eulen als Lerchen. Die meisten Menschen (60 Prozent) zählen jedoch zu den Normal- oder Indifferenztypen: Sie mögen den Abend genauso wie den Morgen. Auch sie haben aber bestimmte Zeiten, in denen sie leistungsfähiger sind.
Um herauszufinden, zu welchem Typus man zählt, gibt es einen Selbsttest, basierend auf dem Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) von James A. Horne und Olov Östberg. Doch im Grunde reicht es, sich folgende Frage zu stellen: Geht es mir morgens oder abends besser? Wer das klar beantworten kann, weiß, wie er „zwitschert“.
Die hierzulande üblichen Schul- und Arbeitszeiten sind übrigens an Lerchen orientiert. Sie schaffen sowohl für Eulen als auch für Normaltypen Probleme. Um morgens in die Gänge zu kommen, brauchen sie mehrere Wecker und starken Kaffee. Oder einen toleranten Chef.
Dazu kommt, dass sämtliche Vogerln miteinander leben müssen. „Fast jede durchschnittliche Familie ist eine zeitliche Patchwork-Gemeinschaft; sie vereint unterschiedliche Chronotypen, die sich alle aufeinander einstellen müssen“, sagt Chronobiologe Till Roenneberg. Arbeitgeber müssten darauf auch reagieren: „Extreme Lerchen sollen keine Nachtschichten machen müssen und extreme Eulen keine Frühschicht.“
Auch das Liebesglück ist eine Frage der Zeit: Leben Eulen mit Lerchen zusammen, verbringen sie weniger Zeit miteinander und haben weniger Sex. Verständnis für den Biorhythmus des Partners hilft da ebenso wie eine positiv-liebende Einstellung. Schließlich bedeuten unterschiedliche Biorhythmen Autonomie: Geht die Lerche früh ins Bett, so hat die Eule mehr Lebenszeit für sich; schläft die Eule morgens länger, hat die Lerche Me-Time. Die Eule darf abends kochen, die Lerche ist für das Frühstück zuständig.
Chronotypen verändern sich im Laufe eines Lebens. Kinder sind zuerst Lerchen, werden als Teenager und junge Erwachsene zu Eulen, mit den Jahren geht’s dann erneut Richtung Lerche. Und was können Eulen tun, um sich das Leben gegen den Rhythmus zu erleichtern? Power Naps (15–30 Minuten) machen ebenso fit wie regelmäßige Bewegung. Nachttypen sollten besonders darauf achten, vor dem Schlafengehen nicht noch ins Smartphone zu starren. Dessen Blaulicht verzögert die Ausschüttung des Schlaf hormons Melatonin – man wird noch wacher.
Um morgens nicht ganz orientierungslos durchs Leben zu taumeln, hilft es, schon am Vorabend das Outfit für den nächsten Tag herzurichten. So bleibt mehr Zeit, um sich frühmorgens im Bett ein bisschen zu bewegen oder beim offenen Fenster eine belebende Sauerstoffdusche zu nehmen.
Wie finde ich meinen Rhythmus?
Für ein glückliches, gesundes Leben gibt uns die Natur den Takt vor. Er ist eine große Symphonie der Rhythmen aus Jahres- und Mahlzeiten, aus Sonnenstand und Millisekunden. Ein Grazer Wissenschaftler kennt ihn.
Univ.-Prof. Dr. Maximilian Moser von der MedUni Graz ist einer der spannendsten Wissenschaftler Österreichs: Er hat mit Kosmonauten geforscht und das Geheimnis der Zirbe gelüftet. Und er ist international taktgebender Chronobiologe, also Experte für die Lehre von der inneren Uhr unseres Lebens. Bis vor kurzem wurde dieser Zweig der Wissenschaft noch ein wenig ins esoterische Eck geschoben, doch im Jahr 2017 rückte die Chronobiologie spektakulär ins Rampenlicht, als den US-Forschern Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young der Nobelpreis für Medizin verliehen wurde. Ihre Studien trugen viel dazu bei, die inneren Uhren des Menschen zu entschlüsseln.
Wer bestimmt diesen Rhythmus denn genau? Und wer stellt eigentlich die Uhren in unserem Körper? „Natürliche Rhythmusgeber sind Licht, Nahrung und Schlaf“, sagt Moser. „Sie sind maßgeblich für das Wohlbefinden und die Gesundheit.“ Unsere inneren 24-Stunden-Uhren skizziert Moser aber keineswegs als gestrenge Taktgeber oder gar starres Metronom, sondern als sanfte, geduldige und vor allem wohlwollende Begleiter: „Sie zwingen nicht, aber sie machen geneigt, wie Goethe einst über die Sterne sagte. Das heißt: Es wird etwas begünstigt, was zu einer anderen Zeit nicht begünstigt ist.“
Doch nicht nur unser Tagesrhythmus beeinflusst die Parameter und Funktionen von Körper, Geist und Seele, vielmehr „existiert eine Vielzahl verschiedener Rhythmen, die alle zusammenwirken und eine Art Zeitorganismus ergeben“.
Der gezogene Zahn der Zeit
Beginnen wir beim langsamsten aller regelmäßig wiederkehrenden Rhythmen, dem Jahreslauf. „Jeder von uns weiß, dass man im Herbst leichter zunimmt, weil da der Winterspeck angelegt wird. Wer Gewicht verlieren möchte, wählt dafür das Frühjahr. Sonst arbeitet man gegen die innere Uhr“, erklärt Moser.
Der Herbst wiederum ist eine gute Zeit für kleine Auszeiten im Dienste der Gesundheit. „Studien haben gezeigt, dass die Wirksamkeit von Kuren im September oder Oktober um etwa 20 Prozent höher ist als etwa im Jänner oder Februar.“ Auch Wochenrhythmen gibt es. Manche Krankheiten folgen beispielsweise einer Sieben-Tage-Logik. „Scharlach bei Kindern klingt in einem siebentägigen Rhythmus ab, nach dem ersten Fiebergipfel kommt es zunächst zu einer Abnahme der Körpertemperatur, nach sieben Tagen steigt sie wieder leicht, um wieder abzufallen und nach zwei Wochen wieder anzusteigen“, sagt Moser. Er wertet das als „gesund“ und Teil eines ungestörten Heilungsverlaufs.
Das gilt interessanterweise auch fürs Ziehen eines Zahns: „Die Schwellung der Wange klingt zunächst ab, nach einer Woche schwillt sie wieder leicht an, ebenso nach vierzehn Tagen. Nach drei Wochen sollte der Spuk vorbei sein.“
Wenn das Herz tanzt

Bild: Marina Munn
Der allerschnellste Rhythmus findet sich im Nervensystem, mit Tausendstelsekunden im Bereich der schnelleren Nerven bis hin zu den langen Theta-Wellen in unserem Gehirn, wenn wir schlafen. Der Stoffwechsel hingegen tickt relativ langsam, im Bereich von Stundenrhythmen. Die Durchblutung folgt einem Minutenrhythmus. Dazwischen, nämlich im Sekundenbereich, liegt das Herz-Kreislauf-System.
Biologisch unterliegen wir also einem wirklich breiten Spektrum der Taktungen. Das Faszinierende daran: All diese Rhythmen arbeiten zusammen. „Man darf sich das wie das Zusammenspiel von Muskeln vorstellen. Sie verstärken und schwächen einander“, erklärt Moser. Wenn man etwa langsam atmet, passt sich die Herzschlagrhythmik an die Atmung an. Das hat manchmal praktische Auswirkungen: „Wenn wir zum Beispiel Mantras im Rahmen einer Meditation rezitieren, erzeugen wir damit eine andere Herzschlagrhythmik. So lässt sich die positive Wirkung dieser Form von Mediation erklären“, meint Moser.
Natürlich ist der Herzschlag selbst ebenso ein Rhythmus – auch wenn er nie gleichförmig verläuft, sondern ständig schwingt. „Das Herz tanzt mit der Atmung, mit dem Blutdruck und auch mit dem Rhythmus unserer kleinen Blutgefäße“, formuliert es Moser in seinem Buch „Vom richtigen Umgang mit der Zeit“. Und er betont, wie sehr wir davon profitieren, wenn wir den natürlichen Rhythmen der Natur folgen: „Geraten die inneren Schwingungen außer Takt, hat dies Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden.“ Diese Folgen reichen von Befindlichkeits-, etwa Gedächtnisstörungen bis zu neurologischen und psychischen Erkrankungen. Sogar schwere Krankheiten wie Krebs oder Herzinfarkt können entstehen, wenn wir die biologischen Rhythmen dauerhaft ignorieren. Moser: „Man weiß, dass bei dauerndem Jetlag oder Schichtarbeit die Raten für Brustkrebs oder Prostatakrebs um teilweise bis zu 50 Prozent ansteigen können.“
Mehr Flexibilität, mehr Pausen
Doch wie sieht nun ein rhythmusbewusstes Leben aus? Maximilian Moser erinnert an die Zeit unserer Urgroßeltern und Großeltern. „An ihnen können wir uns sehr gut orientieren. Sie haben regelmäßig gegessen, sind regelmäßig zu Bett gegangen und regelmäßig aufgestanden. Nacht- und Schichtarbeit waren kein Thema. Es gab weder Fernsehen noch Smartphone.“ Dabei gibt es nur ein kleines Problem: Die Zeitläufe lassen sich nicht so einfach zurückdrehen.
Daher rät der Chronobiologe zu zeitgemäßen Denkansätzen. Wir helfen unserem Körper etwa, indem wir unsere Ernährung ganz bewusst auf die Bedürfnisse der inneren Uhr abstimmen: Moser empfiehlt ein kräftiges Frühstück, durchaus eiweißreich, weil Eiweiß um diese Zeit besser verstoffwechselt werden kann. Für das Abendessen gilt: so leicht und so früh wie möglich. Aber nicht jeder goutiert beispielsweise ein üppiges Frühstück. Ein bisschen Flexibilität braucht es daher auch bei der Interpretation der ganz eigenen inneren Uhr. Dabei kommt es auf den individuellen Chronotyp an („Eule oder Lerche?“).
Apropos Flexibilität: Diese wäre tatsächlich ein großer Gewinn beim Arbeitsbeginn. „Nicht jeder kann und mag um sechs Uhr aufstehen, nicht jeder ist in den ersten Stunden des Tages leistungsfähig“, sagt Moser. Und wenn wir schon beim Thema Leistungsfähigkeit sind: „Der Rhythmik folgend, wird alle ein bis eineinhalb Stunden eine Pause, von zirka einer Viertelstunde eingelegt. Das lohnt sich, weil die Bewältigung der Arbeit dann viel besser vorangeht. Aufgrund von Forschungen ist bekannt, dass die Aufmerksamkeit des Menschen nicht länger als eineinhalb Stunden anhält. Viele kleine Pausen sind deshalb besser als eine lange.“
Raus in die Natur!
Zu guter Letzt der Blick aufs große Ganze unserer Lebenszeit: die Jahreszeiten, die Zyklen der Natur. „Sie erlebbar zu machen ist wichtig. Der Mensch ist Teil der Natur. Daher gilt: Raus mit uns ins Freie, sooft es geht!“ Wer jeden Tag mit einer morgendlichen „Rauszeit“ beginnt, leistet einen ganz großen Beitrag zur jahreszeitlichen Aktivierung. Den Vögeln zuhören, den Sonnenaufgang beobachten, die frische Luft einatmen: „Es gibt viele Möglichkeiten, die Natur in den menschlichen Organismus zu integrieren.“ Maximilian Moser versucht das zumindest am Wochenende. Am Sonntag geht er meist in den Wald, wandern. Auch weil das Erleben von Natur und deren Veränderungen eine wunderbare Möglichkeit ist, im Jetzt zu leben.
Zum Abschluss noch ein Dialog aus „Momo“: etwas zum Nachdenken und um ein bisschen unsere Lebenszeit anzuhalten.
„Dies“, sagte Meister Hora, „ist eine Sternstunden-Uhr. Sie zeigt zuverlässig die seltenen Sternstunden an, und jetzt eben hat eine solche angefangen.“
„Was ist denn eine Sternstunde?“, fragte Momo.
„Nun, es gibt manchmal im Lauf der Welt besondere Augenblicke“, erklärte Meister Hora, „wo es sich ergibt, dass alle Dinge und Wesen, bis zu den fernsten Sternen hinauf, in ganz einmaliger Weise zusammenwirken, sodass etwas geschehen kann, was weder vorher noch nachher je möglich wäre. Leider verstehen die Menschen sich im Allgemeinen nicht darauf, sie zu nützen, und so gehen die Sternstunden oft unbemerkt vorüber. Aber wenn es jemand gibt, der sie erkennt, dann geschehen große Dinge auf der Welt.“
„Vielleicht“, meinte Momo, „braucht man dazu eben so eine Uhr.“ Meister Hora schüttelte lächelnd den Kopf. „Die Uhr allein würde niemand nützen. Man muss sie auch lesen können.“
Text aus dem Roman „Momo“ von Michael Ende. Die 1973 veröffentlichte „Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“ wurde mit über sieben Millionen verkauften Exemplaren ein Weltbestseller, der auch heute noch Jung und Alt inspiriert.



